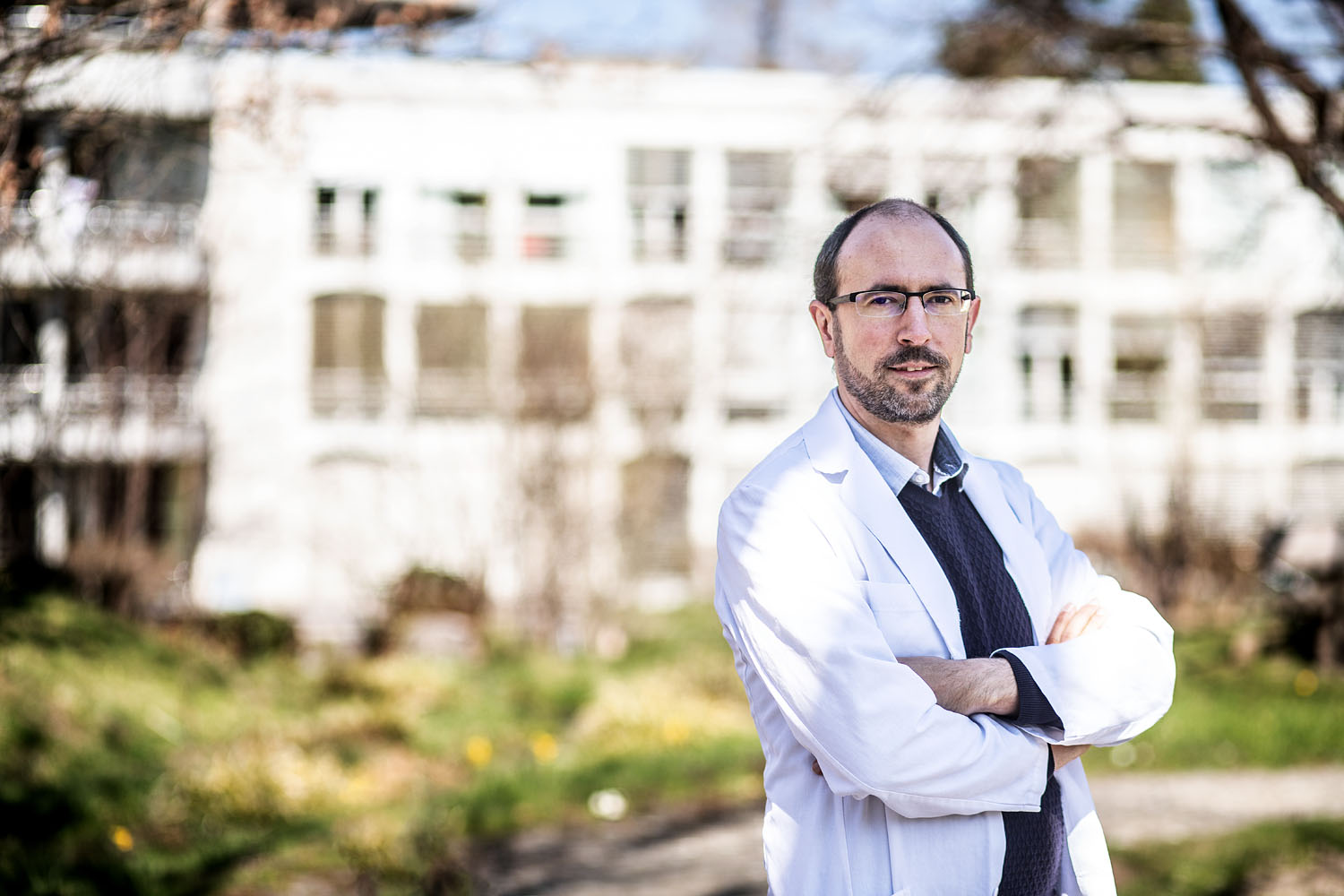
Dr. Thierry Gigandet spricht mit seinen Patient*innen übers Leben, das Sterben und ihre noch gewünschten Therapien. Foto: Pia Neuenschwander
«Triage muss lang vor der Intensivstation beginnen»
Altersmediziner Thierry Gigandet im Interview zur aktuellen Situation
Dr. Thierry Gigandet, 41, ist leitender Arzt im Berner Spitalzentrum für Altersmedizin Siloah in Gümligen und als Heimarzt in verschiedenen Institutionen tätig. Wie gehen er und seine Patient*innen mit dem neuen Alltag während der Corona-Krise um?
Interview: Anouk Hiedl
«pfarrblatt»: Inwiefern hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?
Dr. Thierry Gigandet: Durch die global unterschiedlichen Entwicklungen hatten wir in der Schweiz etwas Vorlaufzeit, die wir meines Erachtens sehr gut genutzt haben. Daher haben wir die Massnahmen des Bundesrats teilweise bereits vorher umgesetzt oder vorbereitet. Wir versuchen nun, stationäre und ambulante Prozesse so gut wie möglich zu trennen. Hygienemassnahmen sind noch zentraler geworden. An die Arbeit mit Schutzmaske haben wir uns schon etwas gewöhnt, und bei Verdachtsfällen oder bestätigten Corona-Infektionen tragen wir zusätzliche Schutzkleidung.
Konsultationen finden manchmal telefonisch oder gar per Mail statt. Das ist eine zusätzliche Herausforderung, weil ich so maximal die Stimme der Patient*innen höre und weitere Infos aus einer unmittelbaren Begegnung nicht habe. Mit dem Besuchsstopp fallen direkte soziale Kontakte im Spital und Pflegeheim weg. Viele akzeptieren das nicht so einfach und sind enorm herausgefordert. Aktuell ist einzig für Sterbende Besuch zugelassen.
Wie gehen Patient*innen, Angehörige und Mitarbeitende mit der aktuellen Situation um?
Das hängt unter anderem davon ab, wie eng die Beziehungen in den Familien vorher waren, auch von der Lebenseinstellung, dem religiösen Hintergrund, der eigenen Persönlichkeit und dem gesundheitlichen Zustand. Es gibt Patient*innen, die länger im Spital bleiben möchten, da sie aktuell zu Hause weniger Unterstützung und Kontakte hätten. Die Angehörigen können sich momentan kein eigenes Bild vom Allgemeinzustand ihrer Liebsten machen und müssen sich auf ihre Aussagen und die Beurteilung der Pflegenden und Ärzt*innen verlassen. Wir Mitarbeitenden wissen nicht, was auf uns zukommt und hoffen, nicht mit Zuständen wie in Italien konfrontiert zu werden.
Hat sich der Austausch mit Mitarbeitenden und Patient*innen verändert?
Er ist fokussierter geworden. Viele Patient*innen sind gut über die weltweite Lage informiert, kennen die erschwerten Bedingungen und stellen bei der Arztvisite konkrete Fragen. Andere wollen oder können sich nicht mit der aktuellen Situation befassen. Massnahmen und Entscheidungen müssen wir achtsam, im Team, mit ihnen und ihren Angehörigen treffen. «Corona» ist auch unter den Mitarbeitenden allgegenwärtig – von Symptomen über Sofortmassnahmen bis hin zur Patientensituation. Aufgrund der teilweise jahrelangen Betreuungssituation in Pflegeheimen entstehen persönliche Bindungen zwischen Bewohner*innen und Pflegenden. Letztere wissen von den Ansichten und Wünschen der Patient*innen.
Haben Sie Mitarbeitende oder Patient*innen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben?
Leider ja. Die meisten Fälle sind glücklicherweise relativ mild verlaufen. Es gab aber auch schon Todesfälle. Die Mitarbeitenden in Heimen mit bestätigten Corona-Infektionen sind zusätzlich beansprucht – durch Ausfälle im Team, die Betreuung von Erkrankten und Sterbenden, zu denen oft ein enger Kontakt besteht, und die emotionale Belastung.
Welche Therapien kommen für betagte Coronapatient*innen in Frage?
Grundsätzlich unterscheiden sie sich in der Altersmedizin nicht von jenen bei jüngeren Patient*innen. Die meisten älteren Patient*innen haben sich bereits vor der Corona-Pandemie überlegt, wie weit die heute verfügbaren medizinischen Möglichkeiten bei ihnen ausgeschöpft werden sollen und dies teilweise in einer Patientenverfügung erfasst. Da es leider (noch) keine heilende Behandlung bei Corona-Infektionen gibt, steht ausserhalb der Intensivstation die sogenannte symptomorientierte und -lindernde Therapie im Vordergrund. Diese orientiert sich sehr stark an der Palliativmedizin. Oberstes Ziel ist, dass Patient*innen nicht leiden sollen. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Patient*innen, Pflegenden, Ärzt*innen und Palliativmediziner*innen unabdingbar.
Welche Rolle spielen Triagen und Übertherapien im Spital?
Gerade jetzt sind diese Themen wichtiger denn je. Wir diskutieren sie täglich. In vielen Zeitungen wird von der Schwierigkeit der Triage auf Intensivstationen berichtet. Diese sollte aber nicht erst dann erfolgen, sondern muss bereits viel früher beginnen: zu Hause, in Arztpraxen, Pflegeheimen und Spitälern ausserhalb der Intensivstation. Werden Patient*innen direkt in ein Spital mit Intensivstation verlegt, müssen schwierige Entscheidungen dort getroffen werden. Ein Teil wird auf der Notfallstation diskutiert, ein anderer erst auf der Intensivstation. Solche Entscheidungen muss man aber zwingend vorher mit den Patient*innen besprechen. Nur so kann man «sinnlose» Übertherapien verhindern.
Bei Pandemien wie der jetzigen kann eine fehlende Vortriage dazu führen, dass Intensivstationsplätze mit Patient*innen belegt werden, die keine solche Betreuung mehr gewünscht hätten. Im Verlauf der Pandemie sind diese Plätze für andere Patient*innen, für die eine maximale medizinische Versorgung in Frage kommt, dann nicht mehr frei. Oder Intensivmediziner*innen müssen entscheiden, was für wen zur Verfügung steht. Über die Therapiemöglichkeiten zu sprechen, die Patient*innen noch wünschen, ist nicht einfach und sollte in Ruhe erfolgen. Dazu braucht es viel Wissen, Erfahrung und Empathie. Infos über ihr gelebtes Leben, ihre Fragen und ihr Bezug zum Glauben sind für die Entscheidungsfindung sehr wichtig. Was gutes Sterben für sie bedeutet, wo sie sterben möchten und was sie sich in der letzten Phase ihres Lebens wünschen, beeinflusst stark, ob eine Spitalverlegung oder eine intensivmedizinische Behandlung bei einer Corona-Infektion erfolgen soll.
Was werden Sie nicht so schnell vergessen?
Was bleibt, ist die Summe besonderer Erlebnisse. Die meisten sind nicht vom Coronavirus abhängig. Täglich höre ich Berührendes aus den Lebensgeschichten von Patient*innen, von verstorbenen Ehepartnern – Geschichten aus einer anderen Zeit. Jüngst erzählte mir ein Patient über seine Gefangenschaft in einem Konzentrationslager. Gespräche über Schicksalsschläge und den Umgang damit gehören dazu. Auch solche übers Sterben, den Tod und letzte Wünsche, zum Beispiel mit über 90 nochmals aufs Schilthorn zu gehen. Manchmal bleiben aber auch einfach gemeinsame Momente des Schweigens.

Dr. Thierry Gigandet, leitender Arzt im Berner Spitalzentrum für Altersmedizin Siloah in Gümligen.
Foto: Pia Neuenschwander.

