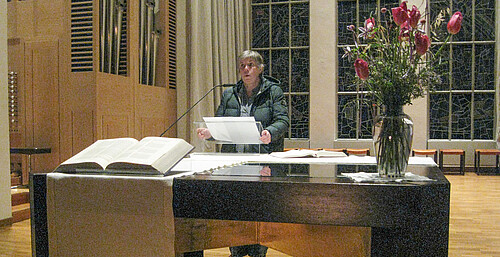Bei Jesus finden wir keine Argumente für Kriegsführung, wohl aber in der kirchlichen Lehre. Fotos: unsplash
Kirche und Krieg: Ein Widerspruch?
Seit jeher setzt sich die Kirche mit dem Thema Krieg auseinander. Ein Überblick über die Lehre des «Gerechten Kriegs» und eine Podcast-Empfehlung.
Annalena Müller
Kirche und Krieg – das schliesst sich aus. Denn Jesus, auf den die Kirche sich gründet, war Pazifist. «Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich», sagt Jesus in der Bibel.
Frieden stiften, Verfolgung ertragen, die andere Wange hinhalten – Jesu Botschaft scheint eindeutig. Und doch gehört der Krieg zur Kirchengeschichte und ja, auch zu ihrer Lehre. Der Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), die offizielle Zusammenfassung der Kirchenlehre, kennt bis heute das Konzept eines «Gerechten Kriegs». Die Kirche anerkennt darin kriegerische Auseinandersetzung als letztes Mittel der Verteidigung unter bestimmten Bedingungen.

Wie vieles in der kirchlichen Lehre ist auch die Lehre vom «Gerechten Kriegs» eine Mixtur antiker Ideen, die für die Kirche prägend waren und die im Laufe der Jahrhunderte durch christliche Denker angepasst wurden. Zum besseren Verständnis der aktuellen Lehre lohnt sich ein Ausflug in die kirchliche Ideengeschichte
Cicero
Die Idee des gerechtfertigten Verteidigungskrieges geht auf Cicero († 43 v. Chr.) zurück. Der römische Philosoph entwickelte Kriterien für einen ethisch verantwortbaren Krieg, um herrschendes Unrecht zu überwinden und seine Idee einer umfassenden Gerechtigkeit zu verwirklichen. Reine Eroberungskriege, wie sie das Römische Imperium führte, liessen sich mit Ciceros Idee nicht vereinen – und stellten einen entsprechend radikalen Bruch mit dem Verständnis seiner Zeitgenossen dar. Selbst bei erlittenem Unrecht blieb der Krieg für Cicero das letzte Mittel. Er plädierte dafür, der Feind müsse die Chance bekommen, Reue zu zeigen und sein Unrecht wiedergutzumachen, bevor man zu den Waffen greife.

Augustinus und Thomas von Aquin
Der Kirchenvater Augustinus (†430), einer der prägendsten Denker des ersten Jahrtausends der Kirche, brachte Ciceros ethische Überlegungen in die christliche Lehre ein. Augustinus’ Werk ist ideengeschichtlich von den grossen Philosophen der Antike, neben Cicero vor allem Platon, geprägt. Und zusätzlich von den Erlebnissen – wir würden heute sagen – Traumata – seiner eigenen Zeit. Die Plünderung Roms durch die Westgoten im Jahr 410 war für die Zeitgenoss:innen ein Schock, der sich in Augustinus’ Hauptwerk, «De civitate Dei» (Von der Gottestadt) niederschlug.
Augustinus ging davon aus, dass Gott ursprünglich eine friedliche Ordnung für die Welt vorgesehen hatte. Krieg und Gewalt sind im augusteischen Denken das Resultat der Vertreibung aus dem Paradies. Sie gehören seither zum Leben, Leid und Martyrium der Menschen dazu. In der nicht-paradiesischen Existenz des Menschen ist es laut Augustinus besonders wichtig, für Christ:innen zwischen legitimen und illegitimen Kriegen zu unterscheiden. Ein legitimer Krieg diene der Wiederherstellung der Ordnung. Augustinus formulierte zudem drei weitere Bedingungen: Der Krieg müsse von Gott oder einer rechtmässigen Autorität angeordnet sein, dem Gemeinwohl und nicht partikularen Interessen dienen und dürfe nur als letztes Mittel eingesetzt werden.
Unter dem Eindruck der Kreuzzüge systematisierte Thomas von Aquin (†1274) , ein weiterer Kirchenlehrer, die Lehre des «Gerechten Krieges» weiter. Wie Cicero und Augustinus anerkennt von Aquin das Recht auf Krieg, wenn eine legitime Autorität ihn anordne, ein zulässiger Grund bestehe und die Kriegführenden eine rechte Absicht hätten. Allerdings steht für den Kirchenlehrer auch fest, dass Krieg generell im Widerspruch zur christlichen Liebe steht.

Das Erbe der Antike
Die Lehre der katholischen Kirche hat sich in den letzten 800 Jahren selbstverständlich weiterentwickelt – wie auch die Kriegsführung. Dennoch wirkt das Erbe der Antike in der katholischen Kirche bis in die Gegenwart. Auch bei den Kriterien für einen «Gerechten Krieg». Diese sind heute deutlich eingegrenzter als in der Zeit ihrer antiken und mittelalterlichen Vordenker, die unter anderem keine Nationalstaaten oder Massenvernichtungswaffen kannten.
Der KKK von 1993 behandelt die Kriterien für einen «Gerechten Krieg» im Zusammenhang mit dem Gebot «Du sollst nicht töten». Und zwar spezifisch für den Fall, dass sich eine legitime Regierung verteidigen muss.
Eine kriegerische Reaktion ist laut Katechismus gerechtfertigt, wenn feststeht, dass die Schäden durch den Angreifer gesichert und von Dauer sind. Auch müssen sich alle anderen Mittel der Konfliktlösung als wirkungslos erwiesen haben und durch kriegerische Antwort auf einen Angriff eine ernsthafte Aussicht auf Erfolg haben. Schliesslich dürfe der zu erwartende Schaden nicht schlimmer sein als das zu beseitigende Übel. Diese Kriterien gelten allerdings nur, solange die Gefahr eines Krieges besteht und es keine internationale Autorität gibt, die solche Konflikte regeln könnte.
Der Podcast «Aufgekreuzt» von katholisch.de hat sich kürzlich mit der Frage «Kirche und Krieg» befasst. Host Gabriele Höfling diskutiert mit dem Ethiker Bernhard Koch und dem Theologen Franz-Josef Bormann über die Entwicklung des Konzepts von der Antike bis ins 20. Jahrhundert.
Literaturtipps
Augustinus von Hippo: De civitate Dei / Über die Gottestadt.
Frederick Russel: The Just War in the Middle Ages (1975).
Grundlagendokument der Deutschen Bischofskonferenz «Gerechter Frieden» (2000).